INDIANER INUIT: THE NORTH AMERICA FILM FESTIVAL
Rauchzeichen auf der Leinwand
Über die Darstellung der Indianer im Film
So kennen wir sie: Wild, barbarisch, blutrünstig. In unzähligen Western sind Indianer die Schießbudenfiguren Hollywoods. Meist völlig unmotiviert mussten sie Postkutschen überfallen, die Forts der US-Armee belagern, die Töchter der Farmer entführen und so den Anlass für rasante Verfolgungsjagden, Kampfszenen und blutige Gemetzel liefern. Unnötig zu sagen, dass zu Schluss stets der gute weiße Held siegte.
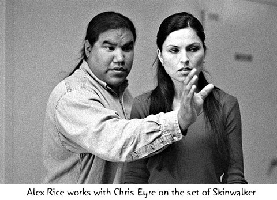 Oder, Klischee Nummer zwei: Der edle Wilde (der immer als Einzelperson auftritt), naturverbunden, das grüne Gewissen verkörpernd, wie in einem amerikanischen Werbespot für mehr Umweltbewusstsein dargestellt: Die weiße Konsumgesellschaft wirft ihren Müll aus einem fahrenden Auto, dem Indianer treibt` s die Tränen in die Augen. Die Handlung der meisten Indianerwestern lebt von Klischees und Vorurteilen gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern.
Oder, Klischee Nummer zwei: Der edle Wilde (der immer als Einzelperson auftritt), naturverbunden, das grüne Gewissen verkörpernd, wie in einem amerikanischen Werbespot für mehr Umweltbewusstsein dargestellt: Die weiße Konsumgesellschaft wirft ihren Müll aus einem fahrenden Auto, dem Indianer treibt` s die Tränen in die Augen. Die Handlung der meisten Indianerwestern lebt von Klischees und Vorurteilen gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern.
Die geschichtliche Wirklichkeit wird verdrängt, man will nicht an den Ungerechtigkeiten gegenüber den Indianervölkern erinnert werden. Dafür schafft man den Mythos des harten aber gerechten Pioniers, der sich und sein Land gegen die Bedrohung durch die Natur und die wilden Indianer verteidigen muss. Das größte Vorurteil ist, dass Indianer immer ernst und stoisch dreinblicken, sagt der bekannte indianische Drehbuchautor Sherman Alexie und verweist dabei auf Karl Mays „Winnetou“.
Dieses Bild hat die ganze Welt von uns, einschließlich Amerika, fügt er hinzu. Dabei seien Indianer die redseligsten und humorvollsten Leute, die er kenne und zitiert selbstironisch aus einem Dialog seines Drehbuchs „Smoke Signals“ (Regie Chris Eyre): „Das einzige, was noch peinlicher ist, als Indianer im Fernsehen sind Indianer, die sich Indianer im Fernsehen ansehen.“ Meine Figuren sind sehr lustig, sarkastisch und sehr intelligent. Sie erzählen komplexe Geschichten, sind nicht einsilbig, sagen nicht nur ,“Hugh, ich Indianer – du weiß“. Intelligente Indianer auf der Leinwand? Das gab` s noch nie, fügt der Drehbuchautor hinzu.
Die Einführung des Tonfilms 1927 schuf ein weiteres Klischee, nämlich das des wortkargen Indianers. Die Kommunikation der Filmindianer beschränkte sich trotz der technischen Möglichkeit nicht selten auf Gestik und Mimik, die den Zuschauern aus den Stummfilmen schon bekannt war. Hollywood hatte seine eigene Vorstellung, wie Indianerstimmen zu klingen haben. In „Scouts to the Rescue“ (1939) z. B. erhielten die indianischen Darsteller einen sogenannten “Hollywood Indian Dialect”, in dem die Produzenten einfach die Dialoge in englischer Sprache aufnahmen und sie dann rückwärts abspielten.
 Mit dem Ton hielten auch Filmmusik und Geräusche Einzug ins Kino. Seither galt z. B. das Trommelsignal als Zeichen, dass Indianer sich dem Geschehen nähern. Im Jahre 1975 kamen indianische Familien und Stammesführer zusammen und sprachen über die fatalen Auswirkungen, die die negativen Bilder in den Medien auf ihre Kinder haben, die immer wieder die gleichen Stereotypen der Indianer darstellten. Lasst uns gegen dieses Image etwas tun, meinten die Betroffenen damals, unter denen sich auch Michael Smith, Gründer und Direktor des American Indian Film Institute & Festival befand.
Mit dem Ton hielten auch Filmmusik und Geräusche Einzug ins Kino. Seither galt z. B. das Trommelsignal als Zeichen, dass Indianer sich dem Geschehen nähern. Im Jahre 1975 kamen indianische Familien und Stammesführer zusammen und sprachen über die fatalen Auswirkungen, die die negativen Bilder in den Medien auf ihre Kinder haben, die immer wieder die gleichen Stereotypen der Indianer darstellten. Lasst uns gegen dieses Image etwas tun, meinten die Betroffenen damals, unter denen sich auch Michael Smith, Gründer und Direktor des American Indian Film Institute & Festival befand.
Michael Smith ist Lakota-Indianer und wuchs in der Fort Peck Reservation in Montana auf. 1969 war er einer von 90 indianischen Aktivisten, die die Gefängnisinsel Alcatraz besetzten. Wie so oft in der Geschichte der Ureinwohner Amerikas ging es auch damals um Landrechte und nicht eingehaltene Verträge seitens der US-Regierung. 1971 wurde das Eiland von der Polizei gewaltsam geräumt. Mit Freunden und Aktivisten aus der damaligen Zeit gründete Michael Smith 1977 das American Indian Film Institute (AIFI) als nicht-kommerzielles Zentrum indianischer Medienkunst.
1979 folgte die Eintragung als Verein, zu deren Gründungsmitgliedern auch der Schauspieler Will Sampson (Einer flog über das Kuckucksnest) gehörte. Die Wurzeln des AIFI reichen allerdings zurück bis ins Jahr 1975, als das erste American Indian Film Festival, unter der Leitung von Michael Smith in Seattle vorgestellt wurde. 1977 wurde das event nach San Francisco verlegt, wo es seine dauerhafte Heimat fand. Heut ist es mit seinen 29 Jahren, das älteste und international anerkannteste seiner Art, das in Form und Darstellung den Ureinwohnern Nordamerikas gewidmet ist.
Seit jener Zeit haben Indianer und Inuit die Kamera selbst in die Hand genommen, bringen ihre eigene Sichtweise filmisch zum Ausdruck und begegnen so den eindimensionalen Klischees, mit denen sie sich immer wieder konfrontiert sehen. In ihrem Themenspektrum offenbaren sich bislang unsichtbare Welten. Die Filme erlauben Einblicke in universelle menschliche Themen wie Kindheit und Jugend, Frau und Mann, Krankheit und Tod aus der Sicht der Indianer und Inuit.
Mehrdimensional beleuchtet der Native American Film Diskriminierung und Gewalt, erweckt Mythen zum Leben und vermittelt das Wirken unsichtbarer Kräfte. Er erzählt von Sehnsucht, Furcht und Trauer und greift das Zeitgeschehen ebenso auf wie mündlich überlieferte Geschichten. Neben der Dokumentation dürfen Humor und der spielerische Umgang mit Klischees nicht fehlen.
Die sensible und oftmals überraschende Inszenierung emotional besetzter Themen gehört zu den großen Herausforderungen, die der Native American Film auf einzigartige Weise meistert. Die klare Erkenntnis, wie sehr man durch das Medium Film die Einstellung des Menschen beeinflussen kann, bestimmte z. B. die Arbeit von Chief Dan George (Squamish), der die große Entdeckung des bedeutenden Regisseurs Arthur Penn war.
In seinem 1970 gedrehten Anti-Western „Little Big Man“ avancierte Chief Dan George neben Dustin Hoffman international zu einem Publikumsliebling. Seine als Berufung empfundene Aufgabe drückte der beliebte Indianerdarsteller in folgenden Worten aus: „Ich kann als Native American eine echte Darstellung geben und dadurch helfen, die Indianer in der Welt des weißen Mannes heimisch zu machen.“
Gunter Lange, INTERKULTUR Stuttgart & VHS Konstanz.
